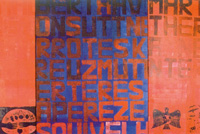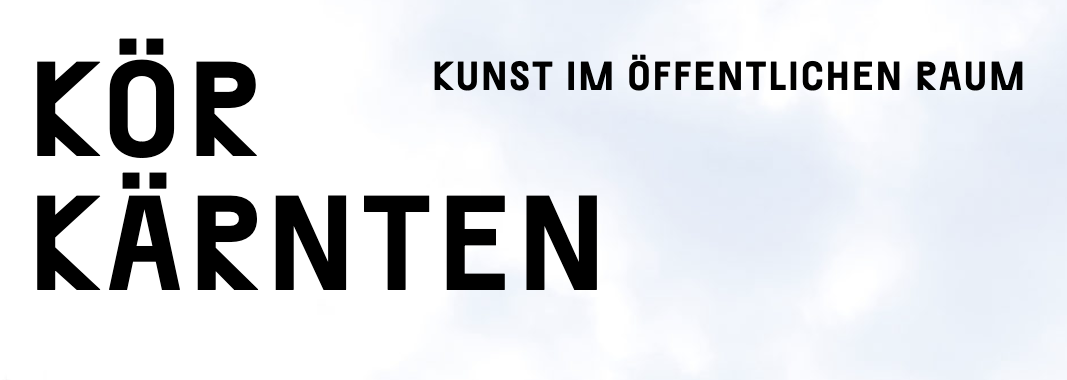Die Zukunft gehört dem Pazifismus
geschrieben am 09.04.2015 15:36Im Überblicksartikel zur Schwerpunktausgabe definiert Werner Wintersteiner, Leiter des Zentrums für Friedensforschung und Friedenspädagogik, den Begriff des Pazifismus und beschreibt die historische Entwicklung.
Die Zukunft gehört dem Pazifismus
Über Bedeutung und historische Entwicklung eines modernen Begriffs
Pazifismus, Kriegsdienstverweigerung, soft power – all dies wird von so genannten Realisten meist als „weltfremd“ abgetan. Dabei zeigen neueste Studien, dass gewaltfreier Widerstand viel effizienter und nachhaltiger wirkt als kriegerische Gewalt. Gehört demnach dem Pazifismus die Zukunft in der (internationalen) Politik?
Niemand hat die Idee des Pazifismus knapper und präziser umrissen als die österreichische Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner (siehe auch Bruecke 155/156). Als Titel für ihren weltberühmten Roman von 1889 wählte sie die drei Worte: „Die Waffen nieder!“ Das ist mehr als der Appell zur Beendigung von Kriegshandlungen. Das heißt auch: Krieg darf kein legitimes Mittel der Politik sein. Die Waffen nieder! bedeutet schließlich Abrüstung in den Köpfen und Entwicklung einer Kultur des Friedens. Doch sehen wir uns die Entwicklung des Pazifismus genauer an.
Das Wort Pazifismus wurde zuerst 1901 von dem Franzosen Émile Arnaud in der Tageszeitung Indépendance Belge gebraucht. Er schlug vor, mit diesem neuen Begriff die Anhänger der Friedensbewegungen zu bezeichnen. Wörtlich bedeutet das Friedensmacher/innen. Damit stellte er sich klar gegen das bereits damals grassierende Vorurteil, dass diejenigen, die für den Frieden eintreten, persönlich friedlich, aber politisch passiv seien. Der Begriff hat sich rasch durchgesetzt und wurde bald zur Eigenbezeichnung der Friedensgesellschaften.
Der Begriff Pazifismus hat keine ein für alle Mal feststehende Bedeutung. Anfangs bezeichnete er vor allem die „bürgerlichen“ Friedensfreunde, im Gegensatz zur antimilitaristischen, aber nicht prinzipiell gewaltkritischen Sozialdemokratie. Revolutionärer Pazifismus als Ausdruck für alle, die Krieg bedingungslos ablehnten, entstand am Vorabend des „Großen Krieges“. Atompazifismus kam nach 1945 auf als Bezeichnung jener, die sich aktiv gegen die Gefahren der Atombombe einsetzen, nicht aber grundsätzlich gegen Krieg.
Diese Beispiele zeigen bereits, dass man verschiedene Spielarten von Pazifismus unterscheiden kann, je nach der ethischen Haltung gegenüber Krieg, Gewalt und Töten. Es gibt Pazifisten, die alle drei Dimensionen gleichermaßen ablehnen und absolute Gewaltfreiheit propagieren. Andere lehnen zwar Krieg ab, akzeptieren aber unter bestimmten Umständen und nach klaren gesetzlichen Regeln den Einsatz von Gewalt (UN Friedenstruppen zum Beispiel), der in Extremsituationen selbst das Töten in Kauf nimmt. Kriegsdienstverweigerer sind hingegen radikale Pazifisten, die mitunter auch harte Strafen riskieren, weil sie sich weigern, andere zu töten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Recht auf Verweigerung zumindest in den meisten europäischen Staaten nach und nach akzeptiert. Die Rehabilitierung der Deserteure des Zweiten Weltkriegs ist noch jüngeren Datums.
Die Idee des Pazifismus ist freilich viel älter als der Begriff. Aus allen großen Kulturen der Welt ist „pazifistisches“ Gedankengut übermittelt, ursprünglich meist in Mythen oder in religiösen und literarischen Texten. Pazifismus in diesem weiten Sinne ist also keine westliche Errungenschaft, sondern die Sehnsucht nach Frieden findet sich bei allen Völkern zu allen Zeiten.
Historische Entwicklung. Die ersten modernen Friedensorganisationen entstanden in den USA und Europa zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dies verweist auf den Zusammenhang zwischen Pazifismus und den Liberalismus des aufkommenden Bürgertums. Sklavenbefreiung, internationale Solidarität der Völker und das Ideal der Humanität waren die Triebkräfte. Auf einem der ersten großen Friedenskongresse, 1849 in Paris, hielt der Dichter Victor Hugo die Eröffnungsrede, in der er prophetisch von den Vereinigten Staaten Europas sprach. Bald entstanden in allen europäischen Ländern Friedensgesellschaften ebenso wie die „Interparlamentarische Union“, eine Vereinigung von Abgeordneten aller Länder für den Frieden. Die österreichische und die deutsche Friedensgesellschaft wurden von Bertha von Suttner und von Alfred H. Fried, dem zweiten österreichischen Friedensnobelpreisträger, gegründet. Auf jährlichen Kongressen entwickelten die Pazifisten vor allem die Schiedsgerichtsbarkeit als Weg, politische Differenzen friedlich beizulegen. Sie setzten große Hoffnungen auf die beiden Haager Kongresse 1899 und 1907, die jedoch mit einer Enttäuschung endeten. Die Großmächte waren an Abrüstung und Konfliktregelung durch Schiedsgerichte nicht interessiert. Erst der Völkerbund nach dem Ersten und die UNO nach dem Zweiten Weltkrieg sollten diese pazifistischen Ideen wieder aufgreifen.
Neben den Friedensgesellschaften war die antimilitaristisch eingestellte Sozialdemokratie eine wichtige Kraft gegen den Krieg. Allerdings schwenkten fast alle sozialdemokratischen Parteien Europas am Vorabend des „Großen Krieges“ auf die Unterstützung der „Vaterlandsverteidigung“ um, mit Ausnahme von Persönlichkeiten wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht oder Lenin, die gegen den Weltkrieg, aber deswegen keineswegs pazifistisch eingestellt waren. Prinzipiell pazifistisch waren viele Anarchisten wie Gustav Landauer in Deutschland oder Pierre Ramus in Österreich. Auch einige wenige Schriftsteller wie Romain Rolland, Stefan Zweig, Prežihov Voranc oder Miroslav Krleža widersetzten sich 1914 der allgemeinen Kriegseuphorie.
Zwischen den beiden Weltkriegen entwickelte Mahatma Gandhi, zuerst in Südafrika, dann im kolonialen Indien, die vielleicht effizienteste und wirkungsmächtigste pazifistische Bewegung überhaupt. Ghandis Philosophie und politische Praxis werden bis heute weltweit studiert und inspirierten die pazifistische amerikanische Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings ebenso wie Befreiungsbewegungen der „Dritten Welt“ oder in Osteuropa.
Der unterschätzte Pazifismus. Nüchtern betrachtet, ist der Pazifismus die einzig vernünftige Antwort auf die Grausamkeiten und die Barbarei des 20. Jahrhunderts. Wir haben derart schreckliche Mittel zur Massenvernichtung geschaffen, dass nur ein gewaltfreier Umgang mit Konflikten innerhalb der Staaten wie international eine Katastrophe vom Ausmaß der Weltkriege verhindern kann. Der Pazifismus inspirierte denn auch die Gründung der UNO, auch wenn die Machtstrukturen innerhalb der Vereinten Nationen oft verhindern, dass sich der Friedensgedanke durchsetzt. Dennoch wird die Kraft des Pazifismus immer noch gewaltig unterschätzt. Der österreichische Dichter Stefan Zweig hat dies einmal „die fast zernichtende Tragik des Pazifismus“ genannt, „dass er nie zeitgemäß erscheint, im Frieden überflüssig, im Kriege wahnwitzig, im Frieden kraftlos ist und in der Kriegszeit hilflos.“ Das dürfte auch der Grund sein, warum in den meisten Staaten die Friedensforschung, also die systematische Untersuchung der Ursachen von Krieg und der Möglichkeiten von Frieden, kaum Unterstützung erhält.
Dabei sprechen die Tatsachen eine andere Sprache: Man denke nur an die serbische Oppositionsgruppe Otpor! (Widerstand!), die nicht nur zum friedlichen Regimewechsel im eigenen Land beitrug, sondern auch Oppositionsgruppen in anderen Ländern, vom Kaukasus bis Ägypten, inspirierte und im gewaltfreien Widerstand trainierte. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Erica Chenoweth, selbst keineswegs Pazifistin, hat vor wenigen Jahren in einer aufsehenerregenden Studie (Why civil resistance works) den Nachweis erbracht, dass pazifistischer Widerstand im 20. Jahrhundert erfolgreicher als jeder Gewalteinsatz war, wenn es darum ging, diktatorische Regimes zu überwinden. In diesem Sinne besteht kein Zweifel, dass dem Pazifismus die Zukunft gehören muss, damit wir auf ein gedeihliches Zusammenleben in einer globalisierten Welt hoffen können.
Werner Wintersteiner
Univ.-Prof. Mag. Dr. Werner Wintersteiner,
Friedenspädagoge und Deutschdidaktiker, ist Gründer und Leiter des Zentrums für Friedensforschung und Friedenspädagogik an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt sowie Mitarbeiter des Österreichischen Kompetenzzentrums für Deutschdidaktik.