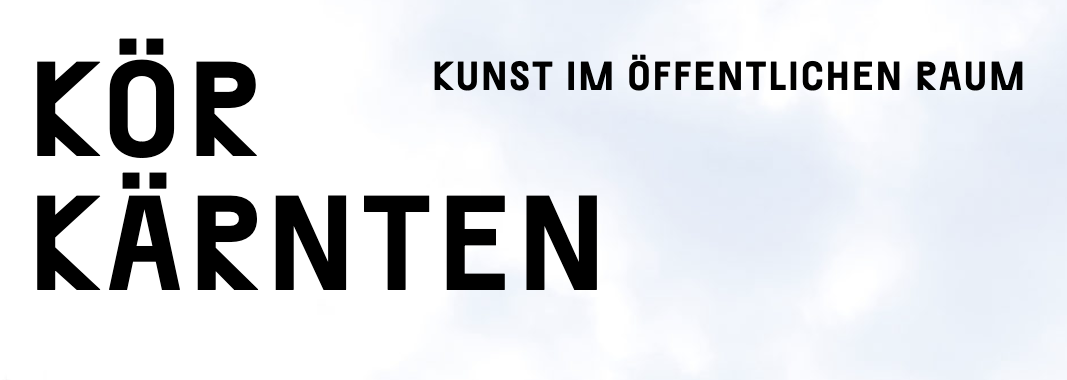The sky is the limit
geschrieben am 26.09.2019 09:54Der Stadionwald irritiert nicht nur Fußballfans. Das For-Forest-Projekt des Schweizers Klaus Littmann ist auch eine Intervention in der Kärntner Kunstszene.
Der Stoff, aus dem die Bäume sind. Es gibt für Kunstmenschen schlechtere Orte, um Anschluss zu finden. Seine ersten Wege in Klagenfurt führten Klaus Littmann auf den Benediktinermarkt, wo Ivo, der Kroate, in seinem Fischlokal dem linksliberalen Bildungsbürgertum den möglicherweise besten Weißwein der Stadt kredenzt. Oder in Vronis Theatercafé. Dort weihten die Künstlerinnen und Künstler der Stadt den Gast aus Basel bei Würstel und Bier in die örtlichen Gegebenheiten ein. Wortreich klagten sie über die Verhältnisse in Kärnten, darüber, was mangels monetärer Mittel hierzulande alles nicht möglich sei. Littmann, der mehr als anderthalb Millionen Euro aufgestellt hatte, um im Wörtherseestadion Birken und Buchen zu pflanzen, hörte sich ihre Geschichten an. Er ist, im besten Sinne schweizerisch, ein guter Zuhörer. Einer, der sich nicht antreiben lässt, wenn es darum geht, ein Urteil zu fällen. Dass die Kunstschaffenden in Kärnten besonders leidenschaftlich leiden, entging ihm gleichwohl nicht.
Das war im Jänner. Der Wörthersee war vereist, wie meist im Winter, das Wörtherseestadion verwaist, wie meist zu jeder Jahreszeit. Die Kunde von dem Kosmopoliten aus Basel, der eine riesige Installation im Stadion plante, machte langsam in Kärnten die Runde, erste Kritikerinnen und Kritiker brachten sich in Stellung. Damit, dass das Projekt „For Forest“ Unverständnis hervorrufen würde, hatte Littmann gerechnet. Das war er von anderen Installationen gewohnt: Überall auf der Welt schütteln Menschen den Kopf, wenn ihre gewohnte Umgebung durch eine künstlerische Intervention verändert wird. Sei es ein Berg von Zucker mitten in New York, eine Plastikhülle über dem Berliner Reichstag oder ein Mischwald im Wörtherseestadion.
Handwerkszeug Irritation. Nicht nur in Kärnten haben viele keine Lust, sich mit den abstrakten Überlegungen dahinter zu beschäftigen. Sie ärgern sich, weil sie die Sache für sinnlos halten. Mit solchen Reaktionen kennt sich Littmann aus, sie sind Teil des Plans. Die Irritation gehört zum Handwerkszeug des Interventionskünstlers wie die polemische Zuspitzung zu einem Oppositionspolitiker oder einer Oppositionspolitikerin. Es verwunderte den Künstler also nicht groß, als die städtische FPÖ gegen den Stadionwald mobilisierte und in ihren Presseaussendungen das Wort Kunstprojekt stets unter Anführungszeichen setzte. Auch in der Schweiz gibt es Rechtspopulisten. Littmann ließ sich nicht aus der Reserve bringen.
Das sollte sich in den folgenden Monaten noch ändern. Spätestens, als bekannt wurde, dass sich mit dem WAC ausgerechnet in diesem Jahr, erstmals in der heimischen Sportgeschichte, ein Kärntner Fußball-Club für die Europa-League qualifiziert hatte und nun aber seine nächsten Spiele gegen die Spitzenmannschaften AS Roma, Borussia Mönchengladbach und Istanbul Başakşehir wegen der Buchen und Birken nicht im Wörtherseestadion absolvieren könne, gingen die Wogen hoch. Die FPÖ kannte praktisch kein anderes Thema mehr als den „Baumfrevel“,es wurde zunehmend ungemütlich für Littmann. Aufgebrachte WAC-Fans wollten den Stadionwald mit Motorsägen abholzen, bei einer Podiumsdiskussion drohte man, ihn an einem seiner Bäume aufzuhängen. Ein Wutbürger wurde sogar gewalttätig und stieß den Künstler vom Gehsteig auf die Straße. „Vaschwind mit deinem Schaswald“, brüllte der Mann noch, ehe er sich aus dem Staub machte. So etwas hatte Littmann tatsächlich noch nicht erlebt. Er sei schockiert gewesen, erzählt er. Aber deshalb aufgeben, sich dem Volkszorn beugen? Ausgeschlossen.
Zug zum Tor. Der Künstler und Kurator ist 67 Jahre alt, wirkt aber trotz seiner schlohweißen Haare jünger. Wenn Littmann spricht, schwingt milde Ironie mit, die darauf hinweisen könnte, dass er mit seinen Mitmenschen etwas fremdelt, sie aber trotzdem mag. Was ihn zum internationalen Starkünstler macht, ist seine mit Unternehmergeist gepaarte Hartnäckigkeit: Vor mehr als 30 Jahren hatte Littmann sich geschworen, Max Peintners berühmte Zeichnung „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ nachzustellen. Das Bild zeigt einen Wald, um den herum ein Stadion gebaut ist, während die Gegend ringsum in grauem Beton ertrinkt. Peintner malte die Dystopie einer Welt, in der die Natur zum Ausstellungsstück zusammengestutzt wird, wie ein Kunstwerk, das man sich nur im Museum ansehen kann. Jahrzehntelang suchte Littmann nach einem geeigneten Ort, bis er vom überdimensionierten Klagenfurter Wörtherseestadion hörte, das um 100 Millionen für die Europameisterschaft 2008 gebaut wurde und seither fast durchgehend nutzlos herumstand. Es dauerte ewig, bis das Projekt auf Schiene war. Zu Jahresbeginn war es dann so weit: Der Kunstunternehmer hatte alle bürokratischen Fragen geklärt und die Finanzierung auf die Beine gestellt. Er übersiedelte nach Klagenfurt, in eine Villa am Viktringer Ring. Von dort aus machte er sich an die Arbeit, mit einer Zielstrebigkeit, die nicht nur Rechtspopulisten unheimlich war.
Die Villa. Das viele Geld. Die Selbstverständlichkeit, mit der Littmann sein international beachtetes Megaprojekt durchzieht. Sein Zug zum Tor. Der Schweizer zeigte auf, was in einem kleinen Land wie Kärnten alles möglich ist. Nicht reden, tun. Anything goes. The sky is the limit. Beileibe nicht alle Kunstschaffenden mögen diese, von keinerlei Selbstzweifeln angenagte Machermentalität.
Der Stadionwald ist nicht nur eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum. Er fordert auch die Kärntner Kunstszene heraus. Ende Oktober werden die Bäume abgetragen und ganz in der Nähe wieder aufgestellt. Littmann legt Wert auf Nachhaltigkeit, sein Projekt soll längerfristig zum Nachdenken anregen: Die einfachen Leute ebenso wie die Kunstschaffenden.
Wolfgang Rössler
39, aus Steindorf am Ossiacher See, lebt in Wien, ist Korrespondent der NZZ am Sonntag.